Funktion und Verfahren der Leberdialyse
Als Leberdialyse bezeichnet man ein Behandlungskonzept bei Leberversagen. Es basiert auf der Dialyse bei Niereninsuffizienz.
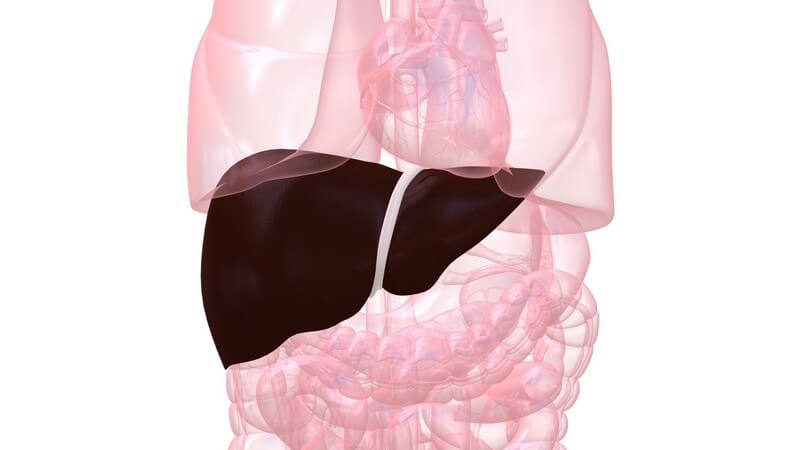
Bei Leberversagen (Leberinsuffizienz) kommt es zum Erlöschen der Leberfunktionen. In den meisten Fällen ist dann eine Lebertransplantation erforderlich. Bis ein geeignetes Spenderorgan zur Verfügung steht, kann es jedoch einige Zeit dauern.
Um diesen Zeitraum zu überbrücken, wird eine Leberdialyse durchgeführt. Dieses Reinigungsverfahren ähnelt der Dialyse (Blutwäsche) bei Nierenversagen.
Darüber hinaus kann die Leber durch die Dialyse entlastet werden, wodurch sie die Möglichkeit hat, sich wieder zu regenerieren. So ist in einigen Fällen sogar eine Selbstheilung der Leber möglich, sofern die Behandlung rechtzeitig begonnen wird. Durch eine solche Selbstheilung lässt sich eine Lebertransplantation unter Umständen vermeiden.

Leberdialyseverfahren
Bei den Leberdialyseverfahren, die derzeit zur Anwendung kommen, unterscheidet man zwischen den zellfreien artifiziellen Verfahren und den zellbasierten bioartifiziellen Verfahren.
Zellfreie artifizielle Verfahren
Zu den zellfreien Methoden gehören das Prometheusverfahren sowie das MARS-Verfahren. Einige Kliniken verwenden zudem die Methode der Bilirubinadsorption, bei der es sich streng genommen aber nicht um ein echtes Verfahren zur Unterstützung der Leber handelt.
Zum Einsatz kommen die zellfreien Systeme sowohl bei akuter als auch bei chronischer Leberinsuffizienz. Auch bei Vergiftungen hat sich ihre Wirksamkeit bewährt. Dagegen gilt die Wirksamkeit der bioartifiziellen Verfahren als nicht hinreichend belegt.
MARS
Die Abkürzung MARS steht für Molecular Adsorbents Recirculation System. Bei diesem Leberdialyseverfahren handelt es sich um eine Weiterentwicklung der Albumindialyse (SPAD). So wird bei dieser Methode humanes Serumalbumin zum Transport genutzt.
Bei Albumin handelt es sich um ein globuläres Protein, welches wasserunlöslichen Stoffen Wasserlöslichkeit vermittelt. Außerdem erhält es den kolloidosmotischen Druck aufrecht.
Im Prinzip lehnt sich das MARS-Verfahren eng an das übliche Dialysesystem an. Das Blut gelangt an einer semipermeablen Membran vorbei und gibt seine Moleküle ab. Darunter sind auch viele Giftstoffe zu finden, die durch die Leberinsuffizienz im Blut angelagert werden.

Durch eine Albuminlösung lassen sich die toxischen Stoffe zu einer so genannten Low-Flux-Membran transportieren. Dort werden die kleineren Moleküle wie Elektrolyte, Harnstoff und Kreatinin ausgetauscht. Außerdem ist es möglich, an dieser Stelle eine Bilanzierung des Patienten vorzunehmen.
Der nächste Reinigungsschritt besteht aus der Abgabe der größeren Moleküle in einem Kohleadsorber sowie einem Ionentauscher. Dadurch wird das Albumin fast vollständig gereinigt, sodass man es erneut der MARS-Membran zuführen kann, wo es weitere giftige Substanzen aufnimmt.
Anwenden lässt sich das MARS-Verfahren in der Regel 8 bis 24 Stunden pro Tag. Entwickelt wurde das MARS-Verfahren, um eine längere Laufzeit der Dialyse sowie einen geringeren Albuminverbrauch zu erreichen.
Prometheus
Eines der modernsten Leberunterstützungssysteme stellt das Prometheus-System dar. Dabei wird eine konventionelle Dialyse mit einer Adsorberbehandlung kombiniert.
Die Basis des Systems bildet ein spezieller Filter, welcher Albumin und Moleküle bis zu einer Größe 300.000 Dalton durchlässt, während Blutplättchen, Zellen sowie Substanzen, die ein größeres Molekulargewicht tragen, im Blut bleiben. Das nur teils durchgelassene Plasma wird als "fraktioniertes Plasma" bezeichnet.
Dieses wird weitergeleitet und mithilfe von Adsorbern können die Toxine aus der Albuminbindung gelöst und dort angeheftet werden. Das gereinigte Albumin wird wieder zurückgeleitet und dem Blut zugeführt. Anschließend erfolgt eine konventionelle Dialyse.
SPAD
Das SPAD-Verfahren (Single Pass Albumin Dialysis) ähnelt dem MARS-Verfahren. So soll dabei das Albumin aus dem Blut des Patienten entfernt werden. Als Variante der SPAD-Methode gilt das CSPAD-Verfahren (Continuous Single Pass Albumin Dialysis).
Im Rahmen des SPAD-Verfahrens wird das Blut über eine Membran, die albuminpermeabel ist, in einem Sekundärkreislauf gegen Albumin dialysiert. Dabei werden die Toxine aus dem Blutkreislauf des Patienten in den Sekundärkreislauf übertragen und das Albmin, an welches sich die Toxine haften, kann verworfen werden.
Im Rahmen der Blutreinigung lösen sich die Toxine, die sich an dem patienteneigenen Albumin befinden, und wandern in Richtung Membran. Das unverbrauchte Albumin, welches sich im Sekundärkreislauf befindet, hat nun freie Bindungsstellen für die Toxinmoleküle, welche dann in diesen Kreislauf übertragen werden.